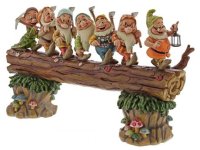raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.833
- 6.168
„Glück Auf“
Bedeutung: Es ist der Gruß der Bergleute. Es ist der Wunsch untereinander, der Verwandten und Freunde, daß man stets nach der harten Schicht ein gesundes Ausfahren aus dem Bergwerk haben wird. Zudem allgemein, daß etwas gelingt. Daß man Glück und Erfolg hat.
Herkunft: Die Formulierung ist der Wunsch der Bergleute. Einmal dafür, daß man stets wieder gesund aus dem Bergwerk wieder herauskommt. Zudem, daß sich die harte Arbeit auch lohnen wird – und nicht vergebens in der Erde schürft. In früheren Zeiten: „Ich wünsche Dir Glück, tu einen neuen Gang auf“ – in der Neuzeit: „Mögen sich Erzgänge auftun“. In Zeiten ohne „Prospektion“ (Im Bergbau und in der Geologie wird mit der „Prospektion“ die Suche und Erkundung von neuen, vorher unbekannten Rohstoff-Lagerstätten nach modernen technischen und wissenschaftlichen geologischen, geophysikalischen, geochemischen und bergmännischen Methoden.) war es reine Frage des Glücks, ob sich die harte Arbeit, ohne technischem Gerät und ohne Sprengstoffe lohnen würde. Nur mit Spitzhacken und körperlicher Arbeit trieb man oft genug Stollen in den Berg oder Untergrund – ohne auf lohnende Vorkommen der wertvollen Rohstoffe zu treffen.
In den ehemaligen Gebieten der Berwerke steht der Begriff aber nicht nur für Bergleute. Es ist seit langem in den Bergbaugebieten ein allgemeiner Begriff geworden , bei dem man sich Glück und Erfolg wünscht.
Bedeutung: Es ist der Gruß der Bergleute. Es ist der Wunsch untereinander, der Verwandten und Freunde, daß man stets nach der harten Schicht ein gesundes Ausfahren aus dem Bergwerk haben wird. Zudem allgemein, daß etwas gelingt. Daß man Glück und Erfolg hat.
Herkunft: Die Formulierung ist der Wunsch der Bergleute. Einmal dafür, daß man stets wieder gesund aus dem Bergwerk wieder herauskommt. Zudem, daß sich die harte Arbeit auch lohnen wird – und nicht vergebens in der Erde schürft. In früheren Zeiten: „Ich wünsche Dir Glück, tu einen neuen Gang auf“ – in der Neuzeit: „Mögen sich Erzgänge auftun“. In Zeiten ohne „Prospektion“ (Im Bergbau und in der Geologie wird mit der „Prospektion“ die Suche und Erkundung von neuen, vorher unbekannten Rohstoff-Lagerstätten nach modernen technischen und wissenschaftlichen geologischen, geophysikalischen, geochemischen und bergmännischen Methoden.) war es reine Frage des Glücks, ob sich die harte Arbeit, ohne technischem Gerät und ohne Sprengstoffe lohnen würde. Nur mit Spitzhacken und körperlicher Arbeit trieb man oft genug Stollen in den Berg oder Untergrund – ohne auf lohnende Vorkommen der wertvollen Rohstoffe zu treffen.
In den ehemaligen Gebieten der Berwerke steht der Begriff aber nicht nur für Bergleute. Es ist seit langem in den Bergbaugebieten ein allgemeiner Begriff geworden , bei dem man sich Glück und Erfolg wünscht.