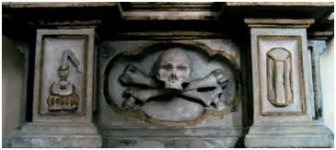raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.832
- 6.168
„Das Salz der Erde sein“
Bedeutung: Die Metapher "Salz der Erde": durch die Wertung Salz als „Weißes Gold“ zu bezeichnen meint diese Redewendung „das Salz der Erde“ eine wertvolle Person.
Herkunft: In der Bergpredigt der Bibel (Matthäus) richtet Jesus an seine Jünger die Aussage: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?" Die Metapher "Salz der Erde" spielt auf eine grundehrliche und hart arbeitende Person an und inspirierte unter anderem Wim Wenders zu einem gleichnamigen Dokumentarfilm und die Rolling Stones zu dem Song „The Salt Of The Earth“ auf dem Album „Beggars Banquet“ (1968 )
Bedeutung: Die Metapher "Salz der Erde": durch die Wertung Salz als „Weißes Gold“ zu bezeichnen meint diese Redewendung „das Salz der Erde“ eine wertvolle Person.
Herkunft: In der Bergpredigt der Bibel (Matthäus) richtet Jesus an seine Jünger die Aussage: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?" Die Metapher "Salz der Erde" spielt auf eine grundehrliche und hart arbeitende Person an und inspirierte unter anderem Wim Wenders zu einem gleichnamigen Dokumentarfilm und die Rolling Stones zu dem Song „The Salt Of The Earth“ auf dem Album „Beggars Banquet“ (1968 )