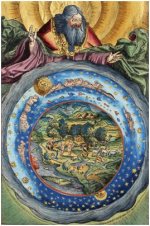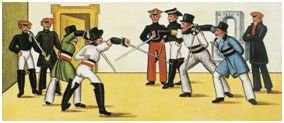raptor230961
Well-known member
- 24 Juli 2016
- 4.833
- 6.168
„Etwas in trockenen Tüchern haben“
Bedeutung:
Die Formulierung bezieht sich meist auf ein Projekt, einen Plan oder einen Vertrag. Die Sache ist zu Ende geführt, abgeschlossen, beschlossen, erledigt.
Herkunft:
Diese Redensart wird hauptsächlich im Geschäftsleben verwendet. Dabei kommt sie höchstwahrscheinlich aus einem ganz anderen Lebensbereich: In nassen Windeln fühlt sich kein Baby wohl. Deshalb werden Kleinkinder nach ihren „Geschäftsabschluß“ immer so schnell wie möglich gewickelt – um es wieder in trockenen Tüchern zu haben.

Bedeutung:
Die Formulierung bezieht sich meist auf ein Projekt, einen Plan oder einen Vertrag. Die Sache ist zu Ende geführt, abgeschlossen, beschlossen, erledigt.
Herkunft:
Diese Redensart wird hauptsächlich im Geschäftsleben verwendet. Dabei kommt sie höchstwahrscheinlich aus einem ganz anderen Lebensbereich: In nassen Windeln fühlt sich kein Baby wohl. Deshalb werden Kleinkinder nach ihren „Geschäftsabschluß“ immer so schnell wie möglich gewickelt – um es wieder in trockenen Tüchern zu haben.