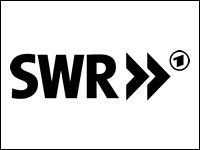Rückblick auf sieben Jahrzehnte: Deutschlands Weg in die NATO
In Brüssel wird der bedeutende Meilenstein des deutschen NATO-Beitritts vor beinahe 70 Jahren mit einem festlichen Akt gewürdigt. Zum feierlichen Anlass versammeln sich hochkarätige Gäste, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der kommissarische Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Veranstaltung wird von NATO-Generalsekretär Mark Rutte geleitet.
Die Bundesrepublik hat am 6. Mai 1955 als 15. Mitglied dem transatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten. Heute zählt die Allianz 32 Mitgliedsstaaten, verstärkt durch den Beitritt Schwedens und Finnlands im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Mit den Feierlichkeiten wird jedoch auch die aktuelle sicherheitspolitische Lage thematisiert, insbesondere der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die Frage der zukünftigen Rollenverteilung innerhalb der NATO.
Die US-amerikanischen Bestrebungen, die Verantwortung für die europäische Sicherheit an die europäischen Partner zu übertragen, werfen Fragen auf. US-Präsident Donald Trump hat klargestellt, dass Europa zukünftig mehr Eigenverantwortung übernehmen soll, insbesondere bei der konventionellen Verteidigung. Der nukleare Schutzschirm der USA soll jedoch bestehen bleiben.
Die Konsequenzen dieser Verschiebungen bedeuten für Europa insbesondere die Notwendigkeit erhöhter Verteidigungsausgaben. Aktuell entfallen mehr als 60 Prozent der NATO-Verteidigungsausgaben auf die USA. Die vorgezogene Feier des deutschen NATO-Beitritts wird aus Termingründen bereits eine Woche vor dem Jahrestag durchgeführt.
Am 6. Mai steht die voraussichtliche Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler im Bundestag auf der Agenda. Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien aus CDU, CSU und SPD ist eine signifikante Steigerung der Verteidigungsausgaben beschlossen worden, um modernste Militärtechnik zu implementieren und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, auch im Weltraum, zu stärken.
Während eine breite gesellschaftliche Unterstützung für die Erhöhung der Verteidigungsausgaben vorherrscht, war die öffentliche Meinung im frühen Nachkriegsdeutschland differenzierter. Damals gab es Befürchtungen, neue Kriegsgefahren heraufzubeschwören sowie die Wiedervereinigung zu gefährden. Befürworter sahen jedoch den NATO-Beitritt als Schlüssel zur Rückgewinnung westdeutscher Souveränität.
Auf internationaler Ebene drängten die USA und Großbritannien darauf, dass Deutschland zum Schutz vor der sowjetischen Bedrohung beiträgt, während Frankreich eine europäische Armee bevorzugte. Ein Konsens wurde erzielt, nachdem Deutschland strikte Bedingungen wie den Verzicht auf Massenvernichtungswaffen akzeptiert hatte.